Sokratischer Dialog
Der Begriff sokratischer Dialog (auch sokratische Methode genannt) geht auf den griechischen Philosophen Sokrates zurück. Ausgehend von seiner Auffassung, dass ein Leben, das nicht kritisch untersucht wird, es nicht wert sei, gelebt zu werden, entwickelte er eine Form des Diskurses, bei dem Reflexion, Selbstbesinnung und Hinterfragen bisher geltender Normen im Mittelpunkt standen. Aus dem ursprünglichen Konzept hat sich eine oft genutzte Methode entwickelt, die hauptsächlich im therapeutischen Bereich sowie in Coaching-Prozessen verwendet wird.
Was ist der sokratische Dialog?
Ursprünglich beschreibt der sokratische Dialog eine Methode des philosophischen Diskurses, die die Dialogpartner zur Reflexion, Selbstbesinnung und Überprüfung eigener Normen und Vorurteile anleiten wollte. Außerdem sollte durch sie das eigenverantwortliche Denken gefördert werden. Als charakteristisches Element des sokratischen Dialogs galt der vollkommene Verzicht auf eine dogmatische Wissensvermittlung.
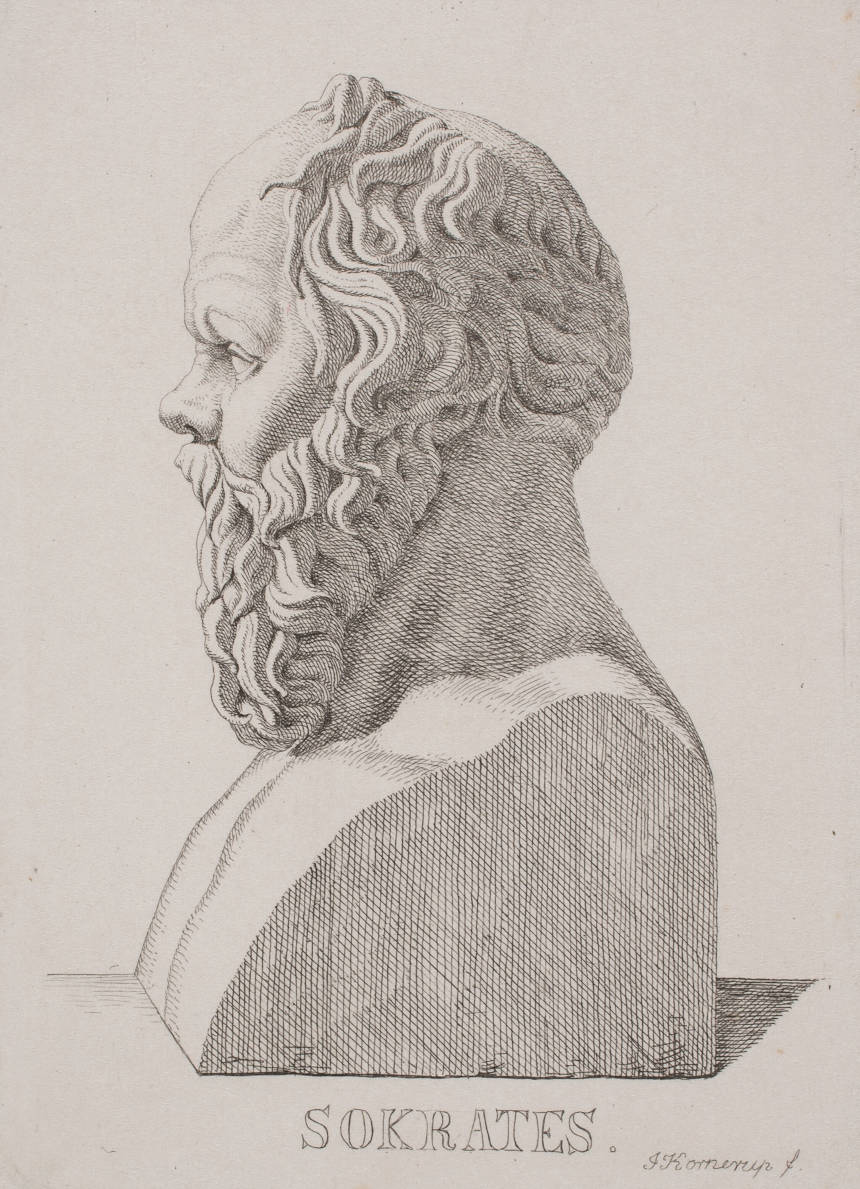
Ziele des sokratischen Dialogs
Die grundlegende Idee des sokratischen Dialogs besteht ja darin, dass der Dialogpartner im Rahmen des geführten Dialogs sich selbst, seine Denkmuster hinterfragt, Widersprüche im eigenen Denken identifiziert und so letztlich zu sich selbst findet. Die vorrangigen Ziele des sokratischen Dialogs, der heute vor allem im Rahmen von Coaching-Prozessen genutzt wird, bestehen darin, dass die Klienten in die Lage versetzt werden:
- für sich selbst Verantwortung zu übernehmen
- eigene Ziele und Lebensinhalte zu entwickeln
- selbstbestimmt zu leben
- das eigene, kritische Denken zu entwickeln und zu fördern
- eigene Werte und Normen festzulegen
- neue, zielführende Überzeugungen und Glaubenssätze zu etablieren
Ablauf des sokratischen Dialogs
Es ist überliefert, dass Sokrates bei seinen Dialogen stets die Position des Nichtwissenden einnahm, nicht belehrte, sondern sich von seinen Gesprächspartnern belehren ließ. Dabei hinterfragte er das vom Dialogpartner Gesagte kritisch und stellte auf Basis der Aussagen seines Gegenübers Schlussfolgerungen an. Auf diese Weise brachte er sie zu einem Punkt, an dem sie erkannten, dass sie die Antworten auf ursprüngliche Fragen nicht geben konnten. Aus dieser Erkenntnis heraus stellten sie sich die Frage noch einmal und suchten nach der richtigen beziehungsweise nach einer besseren Antwort. Den sokratischen Dialog kann man daher in 5 verschiedene Phasen untergliedern:
- Der Lernende teilt sein vermeintliches Wissen mit.
- Der Lehrende hinterfragt das Wissen und weist auf Unstimmigkeiten hin.
- Der Lernende erkennt sein Wissensdefizit.
- Die Ausgangsfrage wird noch einmal gestellt.
- Der Lernende sucht nach Wissen zur richtigen/besseren Beantwortung der Frage.
Beispiel
Um den Ablauf eines sokratischen Dialogs an einem praxisbezogenen Beispiel zu zeigen, könnte man sich vorstellen, dass jemand eine schmerzhafte Trennung von seinem Partner hinter sich hat und diese verarbeiten muss. In einer solchen Situation wird es im Kopf des Betroffenen depressive Gedanken geben, die ihm einreden, er sei schwach und nicht liebenswert. Solche pessimistischen Glaubenssätze könnte er beispielsweise hinterfragen, indem er sich mit der Frage auseinandersetzt, ob denn jeder Mensch, der verlassen wurde, nicht liebenswert ist. Außerdem könnte er fragen, ob ihm jemand einfällt, bei dem das nicht stimmt, was eine Trennung mit seinem Wert als Mensch zu tun hat, was er bisher im Leben schon erreicht hat und ob es Erinnerungen gibt, die ihm zeigen, dass er kein Versager ist.
Mithilfe solcher oder ähnlicher Fragestellungen gelingt es ihm, die depressiven Einflüsterungen kritisch zu hinterfragen, sein Selbstbild zu stärken und für sich selbst neue Normen zu formulieren. Mit diesen kann er sein bisheriges Denken hinter sich lassen und sich in die Lage versetzen, die schmerzhafte Trennung hinter sich zu lassen und positiv in die Zukunft zu schauen.

Heutige Anwendung des sokratischen Dialogs
Der sokratische Dialog, der auch als sokratische Gesprächsführung bezeichnet wird, hat heute als Methode Eingang in die therapeutische Arbeit und ins Coaching gefunden und wird in Form eines Zwiegesprächs durchgeführt. Der Dialog beinhaltet unterschiedliche Fragetechniken und sollte nicht mit dem sokratischen Gespräch verwechselt werden, bei dem es sich um eine von den Philosophen Gustav Heckmann und Leonard Nelson entwickelte, moderierte Gruppendiskussion handelt.
Vor allem in der kognitiven Gesprächs- und Verhaltenstherapie kommt der sokratische Dialog zum Einsatz. Er ist aber auch in der humanistischen Psychologie oder bei psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Ansätzen zu finden. Im Bereich Coaching wird meist die funktionale sokratische Gesprächsführung eingesetzt.
Bei der Bearbeitung dieser Fragestellungen geht es um das konsequente Hinterfragen und Offenlegen von Aussagen, Denkmustern und Widersprüchen von Klienten. Mithilfe dieser kognitiven Methode können dysfunktionale und limitierende Ansichten neu strukturiert werden. Im sokratischen Dialog widerlegt der Klient selbst bisherige Ideen und erarbeitet sich auf diese Weise selbstständig neue Überzeugungen. Solche Veränderungen gelten als sehr stabil und nachhaltig.
Zentrale Fragestellungen im sokratischen Dialog
Zu den zentralen Fragestellungen beim sokratischen Dialog gehören Fragen wie "Was ist das?", "Darf ich das?" und "Soll ich das?". Mit Blick auf den Einsatz des sokratischen Dialogs in den Bereichen Therapie und Coaching müssen vor allem folgende Themen im Mittelpunkt stehen:
- Zielkonflikte
- Wertekonflikte
- Zielunklarheit
- Entscheidungsfindung
- Neuformulierung von Glaubenssätzen, Werten und Normen
- Auflösung des negativen Selbstbildes
Auch im therapeutischen Umfeld beziehungsweise beim Coaching-Prozess ist es entscheidend, dass der Therapeut und Coach die Rolle des Nichtwissenden übernimmt und sich bewusst ist, dass er den Dialogpartner durch kritisches Hinterfragen durch den Prozess führt und dass jede Erkenntnis, Neuformulierung und Veränderung vom Klienten ausgehen muss, um nachhaltig zu sein.
